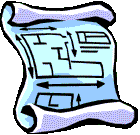
Dieser Raum enthält einen Geheimzugang zu
Kommentaren der Schülerinnen und Schüler Im Augenblick wird beim Anklicken der Bilder nur eine vergrößerte Version geöffnet. Weitere Infos folgen später. |
Religions- und bibeldidaktischer Ansatz des
Projektes Eine wahrscheinlich häufige Erfahrung: Gängige bibeldidaktische Vorgehensweisen stoßen bei Schülern auf Ablehnung, biblische Texte gelten als sperrig, fremd oder schwierig, als langweilig, weil der Text ihren Mediengewohnheiten nicht entspricht, ja sogar, weil der Lesevorgang selbst als schwierig empfunden wird. Zwischen Schülern und biblischem Text bedarf es daher manchmal eines neuen Mittelgliedes. Durch ein Projekt der Jugendkirche TABGHA bot sich hier die Fotografie als Mittel im Dienste der Bibeldidaktik an. Das Ergebnis: wachsende Motivation, hohe Identifikation, eine sehenswerte Fotoausstellung mit dem Titel „Jesus an der Ruhr“ und eine Christologie der Unbefangenheit. Das „CentrO“, Oberhausens „Neue Mitte“, ein
Einkaufs- und Vergnügungszentrum, als „Zeichen“ für
den Strukturwandel im Revier ausgegeben, ein „Wallfahrtsort“
für Hunderttausende Ablenkung Suchende an jedem Wochenende, mit
einer Architektur, die zahlreiche Anleihen in der Geschichte der Sakralbauten
macht, wird zur Kulisse einer bekannten biblischen Szene: Jesus vertreibt
die Händler aus dem Tempel. Da ist zum einen die Verknüpfung von Ästhetik und Botschaft, Jesus-Zeit und Jesus-Botschaft werden mit Ausstattungsmitteln unserer Zeit an vertraute, von den Schülern ausgewählte Orte transferiert, wobei das Aussuchen und die Entscheidung für bestimmte Schauplätze die Identität der Schüler mit ihrer Landschaft zeigt und nebenbei verdeutlicht, welche Fülle und Vielfalt an „spannenden Orten“ das Ruhrgebiet zu bieten hat. Das Medium Fotografie zum anderen hat bei dieser Vorgehensweise den Vorteil der den Schülern vertrauten Bildsprache. Das Problem, die Fotografie für die Abbildung von Wirklichkeit zu halten, hat sich von Anfang an dabei nicht gestellt; es war klar, das Foto ist ein Mittel der Verdeutlichung, der Konzentration auf das Wesentliche der Botschaft. Das Ziel war also keine realistisch-historisierende Fotomontage von Jesus-Szenen, sondern Interpretation mit den Mitteln der Fotografie durch die Projektion des Jesus-Ereignisses in den eigenen Landschaftsraum, verbunden mit der Erkenntnis bei Produzenten und Betrachtern: natürlich ist es nicht so gewesen, Bild, Bildkomposition, Darsteller und Details sind Interpretation, haben Verweischarakter. Anliegen und Ziel dieses Projektes war es also, eine über die Historität hinausgehende Vermittlung des Jesus-Ereignisses zu ermöglichen. Die Vorgabe „Fotoprojekt“ schafft dabei eine fruchtbare Distanz zu den biblischen Texten, die Annäherung an die Person und Botschaft Jesu erfolgt sozusagen auf einem Umweg, der kürzer ist als der direkte Weg. Das „Fotoprojekt“ beinhaltet außerdem die Chance, durch In-Szenierung einen Blick für den Kern der Botschaft zu entwickeln, weil sich bei dieser Vorgehensweise nicht die Frage ergibt, war das so, sondern, was soll mit dieser Geschichte sichtbar gemacht werden? Die unterrichtliche Umsetzung ermöglicht auch deshalb einen hohen Grad an Identität mit dem Projekt, weil die Schüler einerseits den Kern der Botschaft erkennen und wahren müssen; andererseits aber die eigenen Ideen bei Inszenierung und Gestaltung dem persönlichen Zugang und der persönlichen Sichtweise Ausdruck verleihen. Wie aber lassen sich Schüler für ein solches Projekt motivieren, bei dem von Anfang an feststeht, dass es einige Wochen Unterrichtszeit in Anspruch nehmen wird, darüber hinaus auch noch Freizeit für die Fototermine „vor Ort“ investiert werden muss? Einerseits gab es tatsächlich anfangs die üblichen, zu erwartenden Widerstände. Vielleicht gar nicht überraschend, dass für ein solches Vorhaben die Bereitschaft der Mädchen viel größer war als die der Jungen. Andererseits aber konnte sehr bald eine zunehmende und ansteckende Motivation durch die Schüler selbst festgestellt werden. Ein vielschichtiger Prozess kam in Gang. Der Reiz des Projektcharakters, des für den Unterrichtsalltag ungewöhnlichen Mediums, die Chance der Darstellung, die Aussicht, mit einem professionellen Fotografen zusammenarbeiten zu können, das kreative Potential, das selbständige Arbeiten; all das überwog die Bedenken und Vorbehalte, selbst gegen den vorab dargelegten umfangreichen Auftragskatalog. Schließlich mussten vier Evangelien gelesen, Kernstellen herausgearbeitet, Stationen des Lebens und Sterbens Jesu festgelegt werden. Die Schüler mussten sich einigen, welche Station sie jeweils zu verantworten hatten. Dann war ein detaillierter Entwurf für die Fotoszene mit genauen Regieanweisungen zu entwerfen. Der biblische Text musste umformuliert werden in eine gekürzte und vereinfachte Textfassung, die den Kern des Ereignisses betont. Ein begleitendes Protokoll zur Entstehung musste verfasst werden. Die eigenen Entwürfe sollten in der Klasse der Nachfrage und Kritik gestellt, Verbesserungsvorschläge eingearbeitet werden. Der Fototermin musste personell und ausstattungsmäßig organisiert und abgestimmt, zum Schluss noch eine persönliche Stellungnahme zum eigenen Bild und dem Entstehungsprozess formuliert werden. Diese Selbstkontrolle und Reflexion bot, wie bereits die Beschäftigung mit den Evangelien, die Chance, eine Fülle von Einleitungsfragen zu klären, Deutungen und Erklärungen zu diskutieren, Gespräche mit den Schülern zu führen. Sie eröffneten aber auch neue Zugänge, neue Sichtweisen durch die unkonventionelle Betrachtungsweise der Schüler („Könnte Judas nicht auch ein Lieblingsjünger Jesu gewesen sein?“, „Darf man mit Judas Mitleid haben?“, „Kann Jesus durch ein Mädchen / eine Frau repräsentiert werden?“, „Ist es für den Bilderzyklus wichtig, dass es eine Kontinuität bei den Darstellern gibt?“; die Schüler haben sich hier nicht nur aus praktischen Gründen dagegen entschieden!). Die Diskussion über die Auferstehungsproblematik („Wie stellt man das dar?“) erbrachte ein brauchbares Ergebnis: Wenn überhaupt, sollten allenfalls ein leeres Grab oder eine Form der Erscheinung dargestellt werden. Die Schüler entschieden sich schließlich, diese Szene ganz wegzulassen. Die Erarbeitungszeit von sechs Wochen zwischen Ostern und Pfingsten 2002 war eine sehr intensive. Sie war für die Schüler eine Zeit des Austauschs über biblische Botschaften, eine Zeit gegenseitiger und wachsender Motivation (sehr bald gab es keine Bedenken oder Widerstände mehr; selbst die Jungen organisierten wie selbstverständlich ihren Fototermin und sprangen als Darsteller für die Fotos der Mädchen ein!), eine Zeit der gegenseitigen Hilfe und eine Zeit der Erkenntnis. Was ist der Ertrag? Eine „alte, entrückte Geschichte“ hat einen neuen Zugang erfahren. Ein Erkenntnisprozess ist in Gang gekommen: „Ich muss dazu sagen, dass ich anfangs nicht sehr begeistert war, da mir diese Geschichte (hier: Die Hochzeit zu Kana) uninteressant schien. Doch nach und nach bekam sie eine immer größer werdende Bedeutung. Jesus tut in dieser Bibelstelle sein erstes Zeichen ...“ (Lisa G.). Das Leben Jesu ist fassbarer geworden. Außerdem ist dabei herausgekommen eine Bilderserie von insgesamt 26 Bildern, die die WAZ „...ein blutjunges Oberhausener Evangelium“ nennt. Die NRZ sprach von einem „...bildlich wie textlich erregenden Format“ und einer „...sensiblen Bild- und Wortsprache“. Das „Ruhrwort“, die Bistumszeitung aus Essen, stellte die Frage, was den Schülern im Gedächtnis bleibt? „Eine unterhaltsame oder eine beeindruckende Begegnung mit der Bibel? Sicher das Erlebnis Religionsunterricht mal unter freiem Himmel. Vielleicht die Erinnerung an den Mann, der vor fast 2.000 Jahren Feste sogar mit Zöllnern, Obdachlosen, Außenseitern feierte...“. Herausgeber
© Katechetisches Institut des Bistums Essen, Am Porscheplatz 1, 45127 Essen, Januar 2003. Alle Rechte vorbehalten. |
