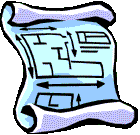
Dieser Raum enthält auch einen Geheimzugang
zu Kommentaren der Schülerinnen und Schüler Im Augenblick wird beim Anklicken der Bilder nur eine vergrößerte Version geöffnet. Weitere Infos folgen später. |
Methodische Anregungen zur Erschließung der Fotos Für den heutigen Menschen ist es oft nicht einfach, Zugang zu einem Bild zu finden. Vielen fällt es schwer, sich auf ein Bild einzulassen und die Botschaft der Bilder zu sehen. Im Eröffnungsmonat, September 2002, wurden in der Jugendkirche TABGHA mit Besuchergruppen unterschiedliche Methoden erprobt, die sich auch für Ihre Arbeit mit Gruppen an diesen Fotos eignen können. Ich habe durch einen Dreischritt versucht den Jugendlichen eine Struktur an die Hand zu geben, mit der sie die Botschaft der Bilder für sich ergründen können. An Hand zweier Bilder ("Der zwölfjährige Jesus unter den Schriftgelehrten" und "Das Tryptichon - Die Beziehung zwischen Judas und Jesus“) versuchte ich sowohl die Unterschiedlichkeit als auch sich wiederholende Elemente in den Bildern zu verdeutlichen. Die nachfolgenden Impulse und Fragen waren bei der Analyse der Bildinhalte hilfreich. 1. Bildinhalt 2. Künstlerische Mittel 3. Bildaussage Ziel dieser Betrachtung war es, zum einen die Bilder in ihrer Fülle zu erfahren und zum anderen die Situationen Jesu mit unserer heutigen Zeit und ganz besonders mit unserer Umgebung in Zusammenhang zu bringen. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich durch diese Strukturierung anschließend den anderen Bildinhalten nähern und den Versuch unternehmen, eine Bildaussage zu formulieren. Im Weiteren stelle Ich ihnen einige erprobte Methoden vor, mit denen Sie die Vertiefungsphase oder Weiterarbeit gestalten können:
Die Jugendlichen sollen Karten mit ausgeteilten Bibelstellen dem richtigen Bild zuordnen. Der Schwierigkeitsgrad ist hier sehr unterschiedlich. Die Zuordnung der Bilder zur Weihnacht und zur Kreuzigung wird wahrscheinlich bei jedem Jugendlichen erfolgreich sein, bei dem Bild des Kreuzweges in einem STOAG-Bus wird jedoch schon ein größeres Abstraktionsvermögen verlangt. Eine weitere Aufgabe kann darin bestehen, die konkrete Zuordnung zum betreffenden Satz innerhalb der Geschichte vorzunehmen. Die Ausstellungsbilder beinhalten schließlich immer nur eine Momentaufnahme aus der jeweiligen Perikope. Man könnte auch ganz unterschiedliche Motive aus den verschiedenen Geschichten darstellen. Die Künstler und Künstlerinnen des Elsa–Brändström-Gymnasiums haben sich für genau ein Motiv aus dem betreffenden Kontext entschieden. Nachdem nun der Zusammenhang hergestellt worden ist, sollen sich die Jugendlichen eine Bibelstelle aus einem Evangelium heraussuchen und sich ähnlich wie die Vorbilder der Ausstellung die Komposition eines „Standbildes“ ausdenken. Dieses Standbild kann der gesamten Klasse vorgestellt und eventuell sogar fotografiert werden. Anschließend kann von jedem Schüler und jeder Schülerin ein Kommentar zum ausgesuchten Standbild geschrieben werden. Ziel ist es, dass die Jugendlichen die Bibeltexte lesen, um eine richtige Zuordnung leisten zu können. Weiterhin wird dadurch die Aktualisierung dieser fast 2000 Jahren alten Texte geleistet. Menschliche Lebenserfahrungen verdichtet im Charakter des Judas Die Schüler/innen des Elsa-Brändström-Gymnasiums haben Judas und Jesus auf verschiedenen Bildern auf besondere Art und Weise mit einem jeweils anderen Charakterzug dargestellt. So wird Judas einmal als der engste Vertraute Jesu (Das letzte Abendmahl) und ein anderes Mal als der Verräter dargestellt. Die Schüler und Schülerinnen haben nun die Aufgabe, sich durch eine Zusammenschau der Bilder ein vertieftes Bild von der jeweiligen Person zu machen. Gegebenenfalls kann ein sogenanntes Phantombild mit den unterschiedlichen Charakterzügen gezeichnet werden. Dies kann auch in Kleingruppen geschehen, um eine erste Kommunikation über eine der beiden Personen zu initiieren. Bei dieser Methode können die Schülerinnen und Schüler nicht nur etwas über die biblischen Personen erfahren, sondern am Beispiel des Judas auch begreifen lernen, dass ein Mensch nicht ausschließlich schlecht oder gut ist. Der Mensch in seinen Zwängen und Entscheidungen wird hierdurch vielschichtig und individuell erlebt. Die Ausstellung als Sehschule Das Einmalige an dieser Ausstellung ist sicherlich die Einbindung der biblischen Geschichte in die Ruhrgebietsregion. Hierbei sprechen die Räume und Requisiten eine symbolische Sprache - diese Ausstellung ist also auch eine Sehschule. Symbole reden von der Hintergründigkeit der Wirklichkeit und sind die eigentliche Sprache der Religion. Im Rahmen der Ausstellung können die Schüler/innen ermitteln, welche symbolische Bedeutung die dargestellten Bauwerke, Gegenstände und Haltungen haben und welche verdichteten Lebenserfahrungen sich dahinter verbergen können. Im Anschluss an diese Aufgabenstellung können sie Symbole und Zeichen benennen, die in ihrem Umfeld von besonderer Bedeutung sind, z.B. das Spurlattenkreuz auf der Halde Prosper Haniel. Um sich dem Symbolbegriff besser nähern zu können, ist es wichtig, dass die Beteiligten an dieser Stelle auch Symbole aus anderen Kontexten vornehmlich aus ihrem Alltag ergründen. Die Erschließung dieser Symbole kann zu einem vertieften Symbolverständnis beitragen. Die in den Kulissen zum Ausdruck gebrachten Lebenserfahrungen treten auf den Fotos in einen direkten Dialog mit der abgebildeten Glaubenstradition. Die abschließende Zielsetzung sollte dementsprechend darin bestehen, diese Korrelationen von Lebenssymbolen und Glaubenssymbolen herauszustellen. Impulse: - Erklärt die Bedeutung der Umgebung für die Aussage des
Bildes? Empfehlungen zur Bildanalyse Bei der Analyse von Bildern bewähren sich generell die Stufen der Bilderschließung von Günter Lange. Die fünf Schritte, die Lange eigentlich für die Begegnung mit Werken der Kunst entwickelt hat, sollen nicht schematisch angewendet werden, aber sie sind in ihrer Abfolge grundsätzlich sinnvoll (vgl. Hilger, Georg, Leimgruber, Stephan / Ziebertz, Hans-Georg, Religionsdidaktik - Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf, München 2001, S. 210f.): 1. "Spontane Wahrnehmung: 2. Analyse der Form und Sprache: 3. Innenkonzentration: 4. Analyse des Bildgehalts: 5. Identifizierung mit dem Bild: Wichtig bei diesen Schritten ist, dass der autonomen Formsprache des Bildes zu ihrem Recht verholfen wird. Der Schlüssel für einen angemessenen Zugang zu einem Bild ist die Verlangsamung des Sehens, die Stärkung der Sehgeduld. In dem Schema enthalten ist die Balance zwischen Distanz und Nähe, zwischen rationaler Analyse und intuitiver Verschmelzung ..." In dem Handbuch "Religionsdidaktik" sind zudem zahlreiche der Methoden zur Arbeit mit Bildern aufgeführt, die Franz Wendel Niehl für den Religionsunterricht zusammengestellt hat (ebd. S. 211). Diejenigen Anregungen, die sich besonders für die Erschließung der Bilder dieser Ausstellung eignen - sei es anhand der Fotos selbst, bei der Weiterarbeit an OHP-Folien oder an Ausdrucken von der CD-ROM, - werden hier genannt: • "Bildbefragung: In Partner- oder Gruppenarbeit werden Schülerinnen und Schüler aufgefordert, Fragen an ein Bild zu stellen; die Fragen an das Bild werden als Wandzeitung präsentiert. Das eignet sich zur Vorbereitung der Bildbetrachtung. • Interview mit dem Bild: Das ist ganz wörtlich gemeint: Ein oder mehrere Schüler richten Fragen an das Bild. Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern bzw. der Lehrende versucht, auf diese Frage angemessen zu antworten. Das setzt natürlich voraus, dass sich eine Gruppe intensiv auf das Interview vorbereitet hat. • Ergänzungscollage: Ein Bild wird auf weißen Karton aufgeklebt. Schülerinnen und Schüler stellen durch Malen und Kleben eine neue Bildumgebung her. Eine Variante: Ein Bildsegment wird ausgeschnitten. Jeder Schüler erhält ein anderes Bildsegment, kann das auf einen DIN-A3-Bogen aufkleben und, von diesem Impuls ausgehend, das Bild vervollständigen. • Verzögerte Bildbetrachtung: Von einem größeren Bild wird zunächst nur ein Teil vorgestellt und interpretiert. Schrittweise wird das ganze Bild so zugänglich gemacht. So kann ein vielschichtiges oder reich gegliedertes Bild in seiner Komposition und in seinen Elementen durchsichtig werden. • Bilddialoge: Wenn ein Bild eine charakteristische Konstellation von mehreren Personen zeigt (z.B. Eltern – Kind; Mächtiger – Unterlegener) erarbeiten die Lernenden einen fiktiven Dialog zwischen den Personen. Der Dialog kann auch szenisch gespielt werden. • Motivverfremdung: Ein Kernstück eines Bildes wird ausgeschnitten und in eine neue Bildumgebung eingefügt, die durch Malen oder Kleben entsteht. So kann etwa bei Motiven aus alter Kunst die Konfrontation mit heutiger Lebenswirklichkeit erfolgen (z. B. ein altes Madonnenbild im Kontext der Welt einer modernen Frau, die Versuchung Jesu heute usw.). • Bilder nachstellen: Die Lernenden erhalten ein Bild, dieses wird szenisch nachgestellt. So kann die Bedeutung der Körpersprache und der Konstellation im Bild nachempfunden und intensiviert werden. Die Sprache des Bildes wird so in eigenes Erleben umgesetzt." Herausgeber
© Katechetisches Institut des Bistums Essen, Am Porscheplatz 1, 45127 Essen, Januar 2003. Alle Rechte vorbehalten. |
